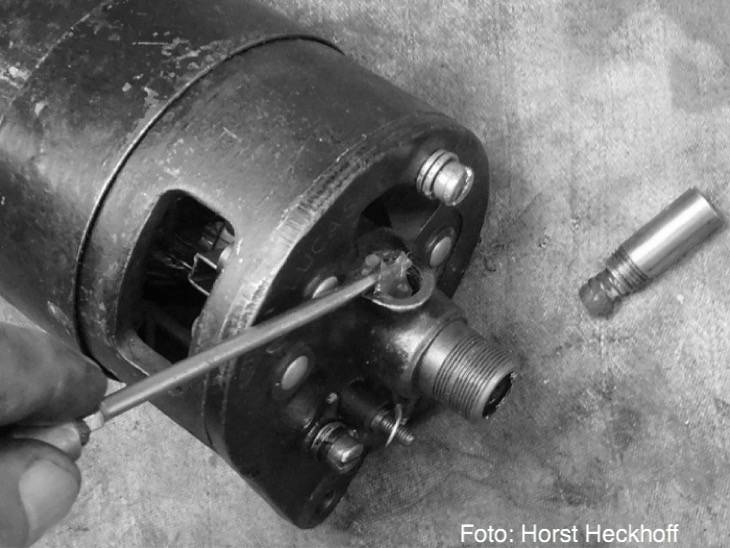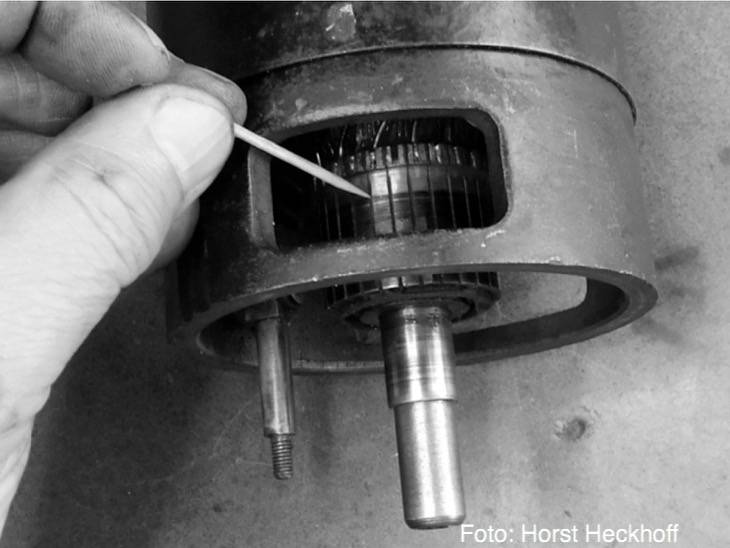Youngtimer sind billig und ungepflegt – Das ist Unsinn
Sie haben ja in Ihrem Newsletter zur Meinungsabgabe aufgefordert bzw. gebeten.
Dem komme ich dieses Mal gerne nach, denn: ich möchte Ihnen sehr leidenschaftlich widersprechen! Ich kann Ihren Ausführungen nicht nur nicht folgen, ich halte sowas auch wirklich für gefährlich und schädlich für unser Hobby!
Zum Hintergrund: ich selber bin Bj. 1967 und besitze mehrere Old- u. Youngtimer im Alter von 20 bis 37 Jahren, darunter auch ein VW Golf 1 GTI sowie ein MB 190 (allerdings die 16V Sportversion).
Die Beobachtung, dass auf vielen Veranstaltungen, sprich: Rallyes, die Fahrzeuge „jünger“ werden, ist nicht ganz falsch. Es kommen ganz natürlich immer mehr Fahrzeuge dazu, die das entsprechende Alter erreichen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Liebhaber und Besitzer „am alten Ende“ auch ganz natürlich weniger werden. Und es ist doch so, man hat immer eine besondere Beziehung zu den Fahrzeugen der eigenen Kindheit und Jugend. Die meisten Liebhaber steigen so mit 40-45 Jahren ein, was ja auch finanzielle Gründe hat, aber auch an der Lebensphase liegt. Daher sind es bei mir persönlich ganz klar Fahrzeuge der 70er bis 90er Jahre, für die ich mich besonders begeistern kann.
Auch Vorkriegs-Oldtimer oder 50er/60er Jahre finde ich toll – aber das war vor meiner Zeit, da kann ich keine persönliche Beziehung oder Leidenschaft aufbauen. Ich finde das insofern ein natürliches, normales Phänomen.
Leider kultivieren Sie offenbar auch einige Vorurteile: Youngtimer rasen, Youngtimer sind billig und ungepflegt, etc. Sorry, das ist m.E. Unsinn. Müssen Oldtimer teuer sein? Ist es erst ein echter Oldtimer, wenn damit reiche Menschen spazieren fahren?! Ich bin auf Rallyes mit sportlichem Charakter mehrfach von einer BMW Isetta oder einem Fiat 500 „geschlagen“ worden.
Der Fahrzeugtyp bzw. die Leistung spielt doch überwiegend überhaupt keine Rolle. Wo wird denn auf Bestzeit gefahren?!?! Die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind vorher bekannt und betragen meistens ca. 25 bis 40 km/h. Wo ist da das Problem?
Was mich persönlich eher stört sind die Mengen an Porsche 911, Käfer Cabrio und Mercedes R107 sowie Pagoden, SL etc. die zum Teil gehäuft von einer „Schickimicki“-Klientel aufgefahren werden.
Aber: jedem Tierchen sein Plaisierchen. Uns eint doch die Liebe zum alten Blech, egal ob 20 oder 60 Jahre alt.
Ich finde es schlimm, wenn sich die Oldtimer- oder Youngtimerfreunde untereinander befeinden, ganz ohne echten Grund. Denn es gibt ja genug echte „Feinde“ die dem Auto an sich oder dem Verbrennungsmotor sehr ablehnend gegenüberstehen. Wie schnell hat man da einen nicht mehr politisch korrekten „Stinker“, der am besten direkt in die Schrottpresse muss! „Echte“ Oldtimer sind nicht nur das teure Hobby betuchter älterer Herren und Youngtimer nicht nur billige Schlurren für den Alltag. Es sind alles Liebhaber-Objekte!
In diesem Sinne würde ich mir mehr „wir“ und weniger Separatismus wünschen. Nur zusammen sind wir stark: :-)
Daher zu Ihren Fragen: nein, keine Einschränkung bei den Ausschreibungen – das gibt es aber natürlich schon und hier sind die Veranstalter frei. Und auch kein H-Kennzeichen erst ab 40. Wer so etwas fordert, untergräbt die mühevolle Lobbyarbeit für unser Hobby in Berlin und an anderen Orten. Im Gegenteil, unser Hobby leidet m.E eher am Nachwuchs. Ich bin 49 Jahre alt und auf vielen Veranstaltungen eher einer der jüngeren Teilnehmer! Ich würde mir vielmehr ein „Mehr“ an Youngtimern wünschen, damit wir auch Menschen im Alter von 20 bis 40 für das Hobby begeistern können. Die Youngtimer von heute sind die Oldtimer von morgen…
Beste Grüße und bitte nehmen Sie meine direkte Wortwahl nicht persönlich. Es ist halt Leidenschaft :-)
Frank Schäfer aus Münster via e-Mail.