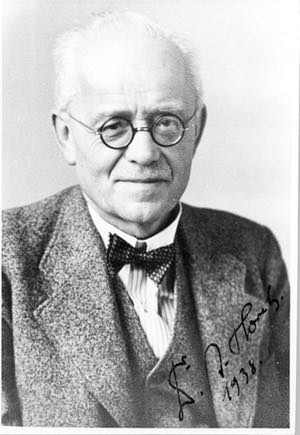Die ersten schnellen Ford RS wurden 50 Jahre alt
Inhalt des Beitrags
Ford RS
Ende der 60er Jahre begann die Autoindustrie normale „Butter- und Brot-Fahrzeuge“ teilweise motorisch, aber auch optisch effektvoller zu gestalten. Das hat auch Ford mit seinen Familienmodellen getan.
Es begann mit dem Ford 15 M RS sowie wenig später mit dem Ford 17 M RS und 20 M RSim Jahr 1968. Alle diese Modelle bekamen die Zusatzbezeichnung „Rallye Sport“ (RS).


Das Ford RS Interieur
Das RS-Interieur bestimmten Drehzahlmesser und Tacho in Großformat und zentraler Anordnung, garniert mit Ampere-Meter und Öldruckanzeige, ein kurzer Schaltknüppel mit holzgemasertem Knauf und Ledersäckchen um den Fuß und ein mit Leder bezogenes Lochspeichen-Sportlenkrad (15 M) beziehungsweise einen Lenkradkranz aus Holzimitat,
Motor Varianten in den schnellen Ford
Für den versprochenen „Dampf unter Haube“ sorgten drei Triebwerke. Unter der Motorhaube des 15 M RS steckt der stärkste Vierzylinder von Ford Köln: eine 1,7-Liter-V4-Maschine mit einer Leistung von 70 PS bei 5000 U/min und einem maximalen Drehmoment von 134 Newtonmetern bei 2400 U/min. Der Motor beschleunigte den Wagen in 14,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verlieh ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h. Die beiden größeren RS-Vertreter waren mit prestigeträchtigen V6-Motoren ausgerüstet, wobei es die 90 PS starke Zwei-Liter-Version des 17 M RS auf eine Beschleunigung von 14,2 Sekunden und 160 km/h Spitzentempo brachte. Beim 2,3-Liter-V6 des 20 M waren es 108 PS, 11,4 Sekunden und 170 km/h. Alle RS-Fahrzeuge wurden in den Farben Rot oder Silbermetallic lackiert.
Start der schnellen Ford Escort
1970 gesellten sich der Escort MKI RS 1600 mit Cosworth-Motor und der Capri MKI RS 2600 mit 200 km/h Spitzentempo dazu. Letzteren befeuerte ein 150 PS und 224 Nm starker V6-Motor. Das reichte, um den Standardsprint in auch heute noch ordentlichen acht Sekunden zu absolvieren. Das Fahrwerk war direkt vom Renn-Capri abgeleitet, und auf Stoßstangen wurde verzichtet. Dabei war das schnittige Coupé mit beheizbarer Heckscheibe, Vollkreis-Ventilation, Kartenleselampe und Bodenteppich durchaus komfortabel ausgestattet. Es blieb nicht viel, was gegen Aufpreis zusätzlich bestellt werden konnte. Es waren ein Stahlkurbeldach, Magnesiumfelgen, hintere Ausstellfenster und ein „Drucktasten-Autoradio“.

Wer sein Vergnügen dann doch lieber auf dem Nürburgring oder auf ähnlichen Rennstrecken suchte, für den stand ja noch die puristische Motorsportvariante mit Türen und Kofferraumdeckel aus Kunststoff, Seitenscheiben aus Plexiglas und schlanken 900 Kilogramm Leergewicht parat. Bei 150 PS entsprach das einem Leistungsgewicht von sechs Kilo pro PS.
1973 wurde an der Hubraumschraube gedreht. In jenem Jahr löste in England der ursprünglich drei Liter große, nachträglich auf 3,1 Liter aufgebohrte „Essex“-V-Sechszylinder die „Kölsche“ 2,6 Liter große „RS 2600“-Motorvariante ab – und schon war der Capri RS 3100 geboren. 250 Exemplare wurden seinerzeit zur Homologation für den Rennbetrieb in der Gruppe 2 gebaut, wobei sich die Firma Cosworth des ursprünglich 150 PS starken Serientriebwerks in bewährter Manier annahm und den Motor mit einem nochmaligen Hubraum-Wachstum auf 3,4 Liter sowie Vierventiltechnik und elektronischer Zündung auf deutlich jenseits der 400 PS aufpeppte. Bei gerade einmal 1000 Kilo „rennfertig“ waren 280 km/h drin.
Der sportliche Escort RS 2000
Eine Ikone der RS-Historie, wenn nicht sogar die RS-Legende schlechthin, ist der Escort RS 2000 der ersten Generation (Mk1) von 1973. Er durfte sich mit den Lorbeeren des in der Rallye-Weltmeisterschaft fahrenden Werks-Escort schmücken. Der Ford Escort RS 2000 vereinte mit seinen 100 PS und 175 km/h Höchstgeschwindigkeit bei niedrigem Gewicht souveräne Fahrleistungen, Alltagstauglichkeit, Servicefreundlichkeit und einen höchst attraktiven Preis.

Der sportliche Capri RS 2600
Wie beim Capri RS 2600 hatten die Ford-Ingenieure das Fahrwerk auf die Erfordernisse des Straßensports zugeschnitten, die Karosserie tiefer gelegt, Federn und Dämpfer angepasst sowie die Kotflügel verbreitert. Schalensitze, Sportlenkrad und Rundinstrumente mit Chrom-Ringen vermittelten das richtige Gefühl im Zweitürer.

Der zwei Jahre später erschienene Nachfolger mit 110 PS benötigte knapp neun Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und rannte bis zu 180 Sachen. Für die Verzögerung sorgte die Bremsanlage des deutlich schwereren 2,3-Liter-Capri, für gute Straßenlage die um zwei Zentimeter abgesenkte Karosserie. Von seinen konventionellen Brüdern unterschied sich der Escort MKII RS 2000 durch eine verlängerte und abgeschrägte Front mit vier Halogen-Scheinwerfern, integrierter Stoßstange und integriertem Luftleitblech. Die im Windkanal geformte „Nase“ aus Plastikschaum reduzierte den Luftwiderstandsbeiwert um 16 Prozent und verringerte zusätzlich den Auftrieb an der Vorderachse um 25 Prozent. Auf der Kofferraumkante thronte noch ein flacher Heckspoiler, der den Auftrieb am Heck um volle 60 Prozent drückte und im Zusammenspiel mit der ausgeklügelten Frontgestaltung eine ausgewogene Aerobalance sicherstellte.
Die sportlichen Escort RS MKII und MKIII
Eher eine Fußnote blieb der Escort MKII RS 1800. Er war im Prinzip ein reines Motorsportgerät und kam mit nur 109 gebauten Exemplaren ausschließlich in England auf die Straße. Für Furore sorgte der Escort MKII in der Rallyeausführung. Mit Björn Waldegård holte er sich 1979 und 1981 mit Ari Vatanen den Weltmeistertitel.

1980 erschien als Prottyp der Escort MKIII RS 1700 T als potenzielles Rallye-Sportgerät nach Gruppe-B-Reglement. Doch das Auftauchen des Audi Quattro am Rallyehorizont war eine Zäsur und machte allen Herstellern schnell klar, dass in diesem Sport ohne Allradantrieb künftig nicht mehr viel zu holen sein dürfte. So wurde der RS 1700 T fallen gelassen und der Weg für den Ford RS 200 geebnet.