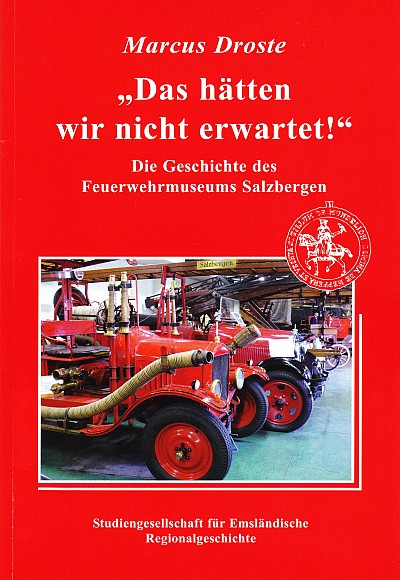60 Jahre Messerschmitt Kabinenroller
Der Messerschmitt Kabinenroller (KR) wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Das „ulkige Automobil“ wurde beim damaligen Flugzeugbauer Messerschmitt gebaut. Es war zu der Zeit, als in Deutschland keine Flugzeuge gebaut werden durften. Ursprünglich war der KR als Fahrzeug für Behinderte konzipiert worden. Der Amerikaner nannte diese Kategorie von Fahrzeugen „Bubble Cars“.
Der Konstrukteur des Kleinstautos war Fritz M. Fend. Die ersten Modelle hießen Fend Flitzer und wurden in Rosenheim gebaut. Im Januar 1953 begann die Serienproduktion des KR 175 im Messerschmitt-Werk Regensburg und im Frühjahr 1953 wurde der KR 175 auf dem Genfer Auto-Salon dem Publikum präsentiert.

Der Messerschmitt Kabinenroller hatte drei Räder und zwei hintereinander angeordnete Sitze, sodass ein ungewöhnlich schmaler, aerodynamisch günstiger Fahrzeugkörper vorhanden war. Die beiden Vorderräder waren lenkbar. Der Motor war im Heck des Fahrzeuges eingebaut und das Hinterrad wurde angetrieben. Später gab es auch Versionen mit vier Rädern. Der Passagierraum war von einer zur Seite schwenkbaren Plexiglashaube abgedeckt und erinnerte an eine Flugzeugkanzel. Die erste Serie Kabinenroller hatte eine Art Motorradlenker mit Drehgasgriff, der ohne Lenkgetriebe über zwei Spurstangen direkt auf die Achsschenkel wirkte. Die Betätigung der Kupplung war anfänglich in den Schalthebel integriert. Später beim KR 200 wurde auf Pedale für Gas, Bremse und Kupplung umgestellt. Für das Rückwärtsfahren gab es ein Zwischengetriebe, das über einen Hebel an der Lenkstange betätigt wurde.
Der KR 175 war mit einem Einzylindermotor mit 173 cm³ Hubraum und 9 PS Leistung von Fichtel & Sachs ausgerüstet. Das reichte für eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Täglich konnten 80 Fahrzeuge im Werk produziert werden. Der Interessent musste anfänglich 2100 DM für das Rollermobil bezahlen.
Anfang 1955 erschien das Nachfolgemodell KR 200 mit 10,2-PS-Motor und 191 cm³ Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 90 km/h. Wie bereits erwähnt, waren, wie bei einem vollwertigen Auto, jetzt Pedale zur Bedienung vorhanden. An der rechten Fahrzeuginnenseite befindet sich der Ganghebel mit „sequentieller“ Ratschenschaltung. Die Funktionen der Ratchenschaltung sind beim nach hinten ziehen, herunter schalten, nach vorn drücken, herauf schalten. Der erste Gang liegt hinten. Da kein Rückwärtsgang vorhanden war, wurde für die notwendige Rückwärtsfahrt der Zweitaktmotor in umgekehrter Richtung angelassen. Der Zündschlüssel wurde eingesteckt und gedreht. Jetzt drehte der Motor rechtsherum und alle vier Gänge können zum Vorwärtsfahren genutzt werden. Beim Einstecken des Zündschlüssels, gleichzeitigem Drücken und Drehen läuft der Motor linksherum. Man kann somit in allen Gängen auch rückwärts fahren, theoretisch also vorwärts so schnell wie rückwärts. Ein mechanischer Rückwärtsgang war nur gegen Aufpreis lieferbar.
Aus dem KR 200 wurden verschiedene Varianten entwickelt. Im Jahr 1955 wurden etwa 12.000 Messerschmitt KR 200 verkauft. Der KR 200 mit seinen vier Varianten KR 200 mit Plexiglashaube, Cabrio-Limousine, Roadster und Sport wurde noch bis 1964 produziert.
Weitere Bilder von Kabinenrollern finden sie mit diesem Link.